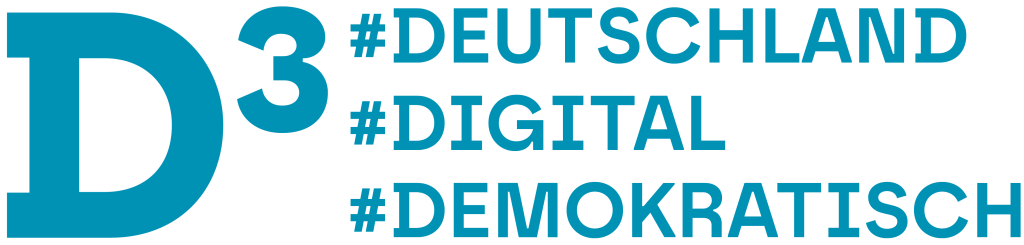Nachhaltige Künstliche Intelligenz
Wo liegen die Grenzen und MöglichkeitenLink zur Session
Derzeit wird künstliche Intelligenz (KI) sowohl innerhalb als auch außerhalb der akademischen Welt als ein Nachhaltigkeits-„Game-Changer“ gehandelt. Zwar existieren zahlreiche nachhaltigkeitsbezogene Anwendungsfälle für KI, insgesamt überwiegen jedoch die konkreten negativen Auswirkungen gegenüber den potenziellen Vorteilen, so die Argumentation dieses Vortrags. Um diese Behauptung zu untermauern, werden drei „KI-Materialitäten“ entlang der KI-Lieferkette unterschieden: Die buchstäbliche Materialität (z. B. Energieverbrauch, Ressourcenausbeutung), die informationelle Materialität (z. B. undemokratische Zentralisierung von Datenmacht) und die soziale Materialität (z. B. ausbeuterische Datenarbeit). In allen Fällen sind die Auswirkungen für den globalen Süden besonders verheerend, während die wenigen Vorteile allein dem globalen Norden zugutekommen.
Auch die viel gelobten angeblich neutralen Optimierungsfähigkeiten von KI etwa für die städtische Verkehrsorganisation sind aufgrund der notwendigen Kriterien (z. B. optimal für Autos, Fahrräder, wenig Emissionen, kurze Wege oder gute Gesundheit), die vor dem Einsatz kollektiv ausgehandelt werden müssen, rein politischer Natur. Daher kann nachhaltige KI an sich die „gläserne Decke der Transformation“ prinzipiell nicht durchbrechen und könnte sogar von notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen ablenken. Tatsächlich nötig ist die grundsätzliche Diskussion, welche positive Rolle KI im globalen Nachhaltigkeitsprojekt überhaupt spielen kann.
Referent:
- Rainer Rehak, Weizenbaum-Institut