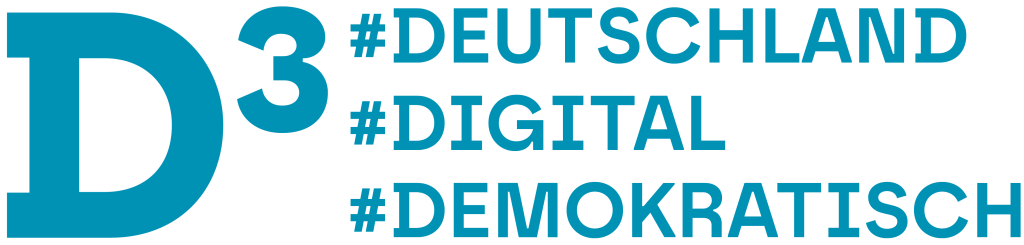Das Programm 2025
In zahlreichen Sessions informieren erfahrene Vortragende aus Theorie und Praxis, aus Politik, Wissenschaft und Medien über unterschiedliche Aspekte des Kongress-Themas. Die Sessions haben unterschiedliche Formate:
- Vortrag (30 Minuten): Vortrag inkl. ggf. Fragen. Die Teilnehmenden haben keine aktive Rolle in der Session.
- Vortrag & Diskussion (60 Minuten): Nach einem Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen zu teilen.
- Workshop (90 Minuten): Intensive praktische Session mit 1–2 Workshopleiter*innen und aktiver Einbindung der Teilnehmenden.
Die angezeigten Sessions können Sie nach unterschiedlichen Kriterien filtern. Wenn Sie für den Kongress angemeldet und eingeloggt sind, können Sie durch einen Klick auf den weißen Stern Ihre persönlichen Favoriten auswählen. Zudem finden Sie bei allen Sessions einen Zugangslink zur Teilnahme. Klicken Sie einfach auf „Link zur Session“ und sie werden direkt in den richtigen Raum geleitet.
11. Nov. 2025
10:00
Gelebte Demokratie in der Digitalen Jugendarbeit
Wie Gaming und Demokratieförderung in der Jugendarbeit funktioniertLink zur Session
Die Digitale Jugendfreizeiteinrichtung "Moving Youth – mySZ" ist ein Discord Server, der vom Evangelischen Jugendhilfeverein e. V. und Spiel & Action e. V. betrieben wird.
Ein Bereich für Jugendliche, der 7 Tage die Woche für 24 Stunden geöffnet hat – pädagogisch begleitet und betreut. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist es, den Jugendlichen ein Bewusstsein für gelebte Demokratie näherzubringen.
Hier nutzen wir verschiedenste Methoden und Beteiligungsverfahren, um möglichst viel Verständnis und Akzeptanz unserer Vorstellung von Demokratie zu vermitteln.
Dies fängt sehr niederschwellig an, mit zum Beispiel einfachen Abstimmungen über Aktionen oder Aktivitäten auf dem Server. Befragungen, Unterhaltungen und Diskussionen sind an der Tagesordnung.
Bis hin zur virtuellen Teilnahme an den U 18, U 16 Wahlen und die dazugehörige politische – Parteien neutrale – Bildung, Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wahlprogrammen – immer auf das jeweilige Verständnisniveau des jeweiligen Gegenübers angepasst.
Selbst die Serverstruktur wird mit Jugendlichen gemeinsam aufgebaut und regelmäßig weiterentwickelt, umstrukturiert und aktualisiert. Da viele Jugendliche eher über Gaming statt über "hochwertige pädagogische Angebote" zu begeistern sind, ist ein großer Teil unserer Arbeit miteinander online zu spielen und hierbei im Sprachchat eher niederschwellig, beispielsweise bestimmte Angriffs- oder Handlungsstrategien zu entwickeln ... und ganz plötzlich werden sehr demokratische Entscheidungen getroffen, nur damit man als Team gemeinsam gewinnt.
Referierende:
- Silvia Härtel, Spiel & Action e. V.
- Vanessa Jeglinski, Ev. Jugendhilfe Verein e. V.
- Holger Hendeß, Ev. Jugendhilfe Verein e. V.
Kartenvielfalt oder Kartenwirrwarr?
Bausteine eines digital zugänglichen StaatesLink zur Session
Die öffentliche Verwaltung bietet ihren Bürger*innen eine Vielzahl kartenbasierter Angebote an: Von interaktiven Stadtplänen und Infokarten über Mängelmelder, Ideen- und Dialogkarten bis hin zu Community-Tools. Diese sind sinnvoll, oft jedoch nicht intuitiv zu bedienen, uneinheitlich designed und schwer auffindbar. Wir sind der Meinung, dass hier viel Potenzial verschenkt wird, denn nutzendenfreundliche Karten, die Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten bündeln, können ein wichtiger Bestandteil eines digital zugänglichen Staates sein.
Dahinter stecken jedoch strukturelle Probleme: Die Digitalisierung der deutschen Verwaltung ist von Föderalismus und Ressortlogiken geprägt. Unterschiedliche Betreiber*innen und Plattformen führen oft zu Insellösungen und Parallelentwicklungen. Im Workshop wollen wir gemeinsam darüber diskutieren, ob eine Vereinheitlichung sinnvoll ist, wie wir sie erreichen können - und welche Rolle die Community bzw. zivilgesellschaftliche Karten-Projekte dabei spielen können.
Im Workshop geben wir einen kurzen Impuls zur demokratiestärkenden Rolle von Karten als Teil eines gemeinsamen digitalen Auftritts des Staates. Dazu wird die Arbeit der Agora Digitale Transformation (einem digitalpolitischen Think Tank) sowie der KERN UX (eine Initiative der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg zur Entwicklung eines Design-Standards für die deutsche Verwaltung) vorgestellt und diskutiert.
Referierende:
- Mathias Großklaus, Agora Digitale Transformation
- Robin Pfaff, Staatskanzlei Schleswig-Holstein
Mehr als ein Klick
Wege zu gerechter digitaler Abstimmung für alle JugendlicheLink zur Session
Wie gestalte ich die digitale Abstimmung in meiner Kommune inklusiv und jugendgerecht? YLC Germany e. V. schafft einen interaktiven Raum, in dem gemeinsam über Barrieren und Potenziale digitaler Jugendpartizipation reflektiert wird – mit einem klaren Fokus auf digitale Abstimmungen. Diese gelten zwar oft als niedrigschwellige Beteiligungsform, bergen aber viele unsichtbare Hürden.
Digitale Beteiligung ist ein zentraler Schlüssel für moderne, zukunftsfähige Jugendpartizipation, aber sie ist nicht automatisch inklusiv. Fehlende Endgeräte, geringe digitale Kompetenz, Sprachbarrieren und strukturelle Ausschlüsse, etwa bei Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, BIPoC*, FLINTA-Personen oder jungen Menschen mit Behinderungen, machen deutlich: Teilhabechancen sind ungleich verteilt.
Gerade bei digitalen Abstimmungen zeigt sich die Lücke zwischen technischem Zugang und echter Teilhabe. Hier setzt der Workshop an: praxisnah, niedrigschwellig und lösungsorientiert, mit Methoden des Peer-to-Peer-Lernens, kommunalem Bezug und Raum für Reflexion. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die sich an den realen Herausforderungen und den Jugendlichen vor Ort orientieren.
Referierende:
- Maja Köhler, YLC Germany e. V.
- Sina Scholzen, YLC Germany e. V.
11:00
Nachhaltige Künstliche Intelligenz
Wo liegen die Grenzen und MöglichkeitenLink zur Session
Derzeit wird künstliche Intelligenz (KI) sowohl innerhalb als auch außerhalb der akademischen Welt als ein Nachhaltigkeits-„Game-Changer“ gehandelt. Zwar existieren zahlreiche nachhaltigkeitsbezogene Anwendungsfälle für KI, insgesamt überwiegen jedoch die konkreten negativen Auswirkungen gegenüber den potenziellen Vorteilen, so die Argumentation dieses Vortrags. Um diese Behauptung zu untermauern, werden drei „KI-Materialitäten“ entlang der KI-Lieferkette unterschieden: Die buchstäbliche Materialität (z. B. Energieverbrauch, Ressourcenausbeutung), die informationelle Materialität (z. B. undemokratische Zentralisierung von Datenmacht) und die soziale Materialität (z. B. ausbeuterische Datenarbeit). In allen Fällen sind die Auswirkungen für den globalen Süden besonders verheerend, während die wenigen Vorteile allein dem globalen Norden zugutekommen.
Auch die viel gelobten angeblich neutralen Optimierungsfähigkeiten von KI etwa für die städtische Verkehrsorganisation sind aufgrund der notwendigen Kriterien (z. B. optimal für Autos, Fahrräder, wenig Emissionen, kurze Wege oder gute Gesundheit), die vor dem Einsatz kollektiv ausgehandelt werden müssen, rein politischer Natur. Daher kann nachhaltige KI an sich die „gläserne Decke der Transformation“ prinzipiell nicht durchbrechen und könnte sogar von notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen ablenken. Tatsächlich nötig ist die grundsätzliche Diskussion, welche positive Rolle KI im globalen Nachhaltigkeitsprojekt überhaupt spielen kann.
Referent:
- Rainer Rehak, Weizenbaum-Institut
11:30
ABSTIMMUNG 21
Die erste bundesweite demokratische Online-AbstimmungLink zur Session
In diesem Vortrag werden die Ergebnisse der ersten bundesweiten demokratischen Online-Abstimmung auf "ABSTIMMUNG 21" mit mehr als 35.000 Teilnehmenden vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei das Verfahren opn.vote, mit dem die Abstimmung durchgeführt wurde. Zudem wird das technische System erklärt und auf die Nutzererfahrungen beim Identifizieren der Identität, beim Bereitstellen der Unterlagen und der eigentlichen Stimmabgabe eingegangen.
Gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutieren wir, wo das Optimum zwischen einfacher Bedienbarkeit und Sicherheit von demokratischen Online-Wahlen liegen soll und wie digitale Infrastruktur gestaltet werden kann, um das demokratische Vertrauen zu stärken, statt es zu gefährden.
Referent:
- Jörg Mitzlaff, openPetition gGmbH
Der Teilhabeindex
Betriebliche Partizipation messenLink zur Session
Der Teilhabeindex (TIX) ist ein wissenschaftlich fundiertes Instrument zur Messung der institutionellen Teilhabe von Beschäftigten.
Ihre wirksame Mitgestaltung der Arbeitswelt steht dabei im Fokus. Neben den klassischen und bewährten Instrumenten der Mitbestimmung wertet der TIX auch freiwillige und informelle Angebote der Mitarbeitendenbeteiligung aus.
Der TIX ist ein Angebot der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) in Kooperation mit dem Berlin Institut für Partizipation im Rahmen des Projektes „Partizipation in der Arbeitswelt“ (PIDA).
Wir stellen das Tool und die Grundlagen dafür vor und diskutieren mit den Teilnehmenden über Einsatzmöglichkeiten, aber auch das Verhältnis von formeller Teilhabe (Betriebsräte, Betriebsversammlungen) und informellen Beteiligungsangeboten durch Arbeitgeber, Betriebsräte und Gewerkschaften.
Referentin:
- Beate Rohrig, IGBCE
Desinformation erkennen mit dem DesinfoNavigator
Ein KI-Tool zur Stärkung der MedienkompetenzLink zur Session
Wie kann Künstliche Intelligenz dabei unterstützen, Desinformation zu erkennen und ihr wirkungsvoll zu begegnen? In einem interaktiven Workshop stellen wir den DesinfoNavigator vor – ein innovatives KI-Tool, das rhetorische Tricks in fragwürdigen Aussagen erkennt und zur Stärkung der Medienkompetenz beiträgt.
Der DesinfoNavigator nutzt ein Sprachmodell, um rhetorische Strategien in potenziell falschen Aussagen zu identifizieren und bietet Nutzer*innen gezielte Hinweise zur kritischen Prüfung. Das non-profit Tool wurde mit dem Ziel entwickelt, Medienkompetenz zu fördern und digitale Teilhabe zu stärken.
Im Workshop erproben wir das Tool gemeinsam und diskutieren über mögliche Einsatzszenarien, Weiterentwicklungen sowie die Chancen und Risiken KI-gestützter Ansätze zur Bekämpfung von Desinformation.
Referierende:
- Dr. Clara Christner, selbstständig
- Lena Beck, scieneers GmbH
- Jan Höllmer, scieneers GmbH
13:30
Alle dabei?!
Digitalisierung und inklusive BeteiligungLink zur Session
In einer Demokratie sollen alle gleichberechtigt mitreden und mitentscheiden können. Doch in der Realität gibt es oft Hindernisse, die den Zugang zu Entscheidungsprozessen erschweren. Daher wollen wir uns der Fragen widmen: Wie können politische Beteiligung und Mitbestimmung für alle Menschen zugänglich gemacht werden – auch für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen?
Im Workshop schauen wir gemeinsam auf das Thema inklusive Beteiligung. Wir klären zentrale Begriffe (bspw. Inklusion, Partizipation) und sprechen über typische Barrieren in Beteiligungsprozessen. Mit Beispielen aus unseren Beteiligungsprojekten schlagen wir die Brücke zur praktischen Umsetzung inklusiver Beteiligung. Wobei besonders die Rolle der Digitalisierung und ihr Potenzial für mehr Beteiligung einbezogen wird.
Im zweiten Teil des Workshops laden wir zum Austausch ein: Welche Themen, Herausforderungen und Erfahrungen bringen Sie mit? Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam Ideen für inklusive Beteiligung zu entwickeln.
Referierende:
- Annika Bachmann, Allianz für Beteiligung e. V.
- Elisa Söll, Allianz für Beteiligung e. V.
- Julian Schulte, Diakonie Kork
- Lukas Wagner, Diakonie Baden
- Martin Maron, Diakonie Baden
DemoK.I.
Wie künstliche Intelligenzen Demokratien stärken könnenLink zur Session
Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik. Das ist kein Wunder, denn wir sehen immer wieder, wie politische Entscheidungen getroffen werden, die nicht nachvollziehbar sind oder komplett an dem vorbeigehen, was uns die Entscheidungsträger*innen noch im Wahlkampf versprochen hatten. Häufig bleibt das Gefühl zurück: Die da oben machen ja eh, was sie wollen. Warum eigentlich?
Ein Grund dafür ist, dass eine Vielzahl der Stimmen einfach nicht gehört werden. Mit K.I. gestützter digitaler Beteiligung bekommt jeder eine Stimme. Menschen, die traditionell aufgrund von Behinderungen oder fehlender Zeit und Informationen ausgeschlossen werden, werden durch den Abbau sprachlicher, räumlicher und zeitlicher Barrieren gestärkt. Um sich im Beteiligungsprozess besser zurechtzufinden, helfen beispielsweise Funktionen wie Spracheingabe, automatische Übersetzung oder digitale Assistenten.
Mittlerweile wird Bürgerbeteiligung in vielen Städten und Kommunen Deutschlands praktiziert, nun geht es um die gemeinsame Gestaltung des Prozesses. Wir zeigen echte Anwendungsbeispiele und diskutieren offen: Was klappt bereits gut? Wo hakt es noch? Und was müssen Kommunen und Entwickler*innen beachten, wenn sie solche Tools einsetzen wollen?
Referentin:
- Julia Thomaschki, Mehr Demokratie e. V.
Wie finden wir in digitalen Verfahren die besten Alternativen?
Argumentieren. Punkten. Bewertungswahl. Nutzwertvergleich. Los.Link zur Session
Erstaunlich oft wird das aus der Kleingruppen-Moderation stammende Punkten genutzt. So erhalten die Beteiligten in vielen Online-Dialogen beispielsweise 5 Punkte, die sie auf bis zu 50 Vorschläge verteilen dürfen. Die Alternativen mit den meisten Punkten werden dann umgesetzt. Aus informationstheoretischer Sicht ist dieses Vorgehen sehr unbefriedigend, da wir weder wissen, wie stark die Zustimmung ist noch welche Meinung die Beteiligten zu den Alternativen haben. Die Bewertungswahl bietet hier mehr. Bei ihr kann jede Person jeden Vorschlag zum Beispiel mit der Note 1 bis 6 bewerten. Das liefert wesentlich mehr Informationen über die Präferenzen der Beteiligten und so ein realistischeres Ergebnis. Nutzwertvergleiche ermöglichen überdies die Berücksichtigung differenzierter Werte und den objektivierenden Einsatz messbarer Indikatoren. Fehlen relevante Unterschiede, dann sollte auch das Los in Erwägung gezogen werden.
Referent:
- Volker Vorwerk, buergerwissen
14:30
Coding the Urban Commons
Herausforderungen ko-produktiver Stadtgestaltung in der Digitalen StadtLink zur Session
Als Bündnis junger Stadtmacher*innen beschäftigen wir uns mit kreativer Stadtgestaltung von unten. In vielen der deutschen Smart City Modellprojekte wird die Zivilgesellschaft, wenn überhaupt, nur punktuell nach ihren Bedürfnissen gefragt. Wir sind der Meinung, dass diese im Sinne der Ko-Produktion von Anfang an in die Entwicklung von Smart City Projekten einbezogen werden muss, um Bedürfnisse abzubilden und Potenziale zu erschließen. Wir stellen unsere Arbeit am Smart City Stufenplan der Bundesregierung vor und präsentieren Projekte, in denen ko-produzierte Smart Cities Wirklichkeit werden. Mit der D³-Community möchten wir unsere Positionen diskutieren, um politische Forderungen weiter zu schärfen und unser Verständnis der digitalen Stadt zu erweitern. Wir fragen uns: Was sind Beispiele für erfolgreiche Kooperationen zwischen Kommunen und der digitalen Zivilgesellschaft? Was braucht es, um diese Zusammenarbeit zu stärken und so die nachhaltige Digitalisierung unserer Städte zu sichern?
Referent:
- Christian Hörner, Verein Urbane Liga e. V.
Data4Good
Ehrenamt für eine digitale ZivilgesellschaftLink zur Session
Die Digitalisierung erfordert einen kompetenten Umgang mit Daten. Nicht nur für Unternehmen und Privatpersonen, sondern auch in der Zivilgesellschaft. Zahlreiche Studien belegen die Potenziale von Datennutzung für gemeinwohlorientierte Organisationen, doch fehlen oft die Kompetenzen und Ressourcen, um diese voll auszuschöpfen. Zusätzlich zu Förderungen durch private Stiftungen und der öffentlichen Hand braucht es strukturelle Lösungen für eine nachhaltige Unterstützung.
In unserem Vortrag zeigen wir, wie CorrelAid e. V. mit pro bono Projekten ehrenamtliche Datenexpert*innen mit gemeinnützigen Organisationen verbindet, um gemeinsam wirkungsvolle, datenbasierte Lösungen zu entwickeln. So entsteht ein Modell, das digitale Teilhabe stärkt, Wirkung sichtbar macht und nachhaltiges Engagement fördert.
Dieser Ansatz bietet eine Win-Win-Situation: Pro bono Datenexpert*innen setzen ihre Kenntnisse für gemeinwohlorientierte Zwecke ein, erweitern ihre Fähigkeiten und engagieren sich (selbst)wirksam für einen guten Zweck. Gleichzeitig erhalten gemeinnützige Organisationen Unterstützung und werden befähigt, Daten kritisch und reflektiert für ihre Ziele und Wirkung einzusetzen. So entstehen als gemeinsame Projekte beispielsweise Reportings oder Dashboards, um Fördergebende zu überzeugen, Wirkungsmessungen und Evaluationen der Vereinsarbeit, Automatisierungen von Prozessen oder grafische Darstellung von Diagrammen (“Data Storytelling”).
Referentin:
- Ann-Kristin Vester, CorrelAid e. V.
15:30
Beteiligungskultur (digital) etablieren!
Wie geht das?Link zur Session
Wie schafft man es, eine (digitale) Beteiligungskultur zu etablieren? Den Weg dahin diskutieren wir mit der Beteiligungsbeauftragten der Stadt Wiesbaden. Anhand von konkreten analogen und digitalen Beispielen und verschieden Handlungsansätzen können Sie Ideen für Ihre eigene etablierte oder noch im Aufbau befindliche Beteiligungskultur sammeln.
Ob Nahverkehrsplanung, Quartiersentwicklung, Jugendbeteiligung oder Fortschreibung einer Strategie, die Stadt Wiesbaden erfreut sich einer aktiven Beteiligungskultur. Wie haben es die Beteiligungsbeauftragten geschafft, die Fachämter hierfür erfolgreich und themenübergreifend einzubinden und zu Beteiligungsexpert*innen zu machen? Und wie ist es ihnen gelungen, eine breite Öffentlichkeit für verschiedene Beteiligungsverfahren zu aktivieren?
Diesen Fragen gehen wir in unserer Best Practice Session nach und freuen uns im Anschluss auf Fragen aus dem Publikum.
Referierende:
- Julia Schauermann, Landeshauptstadt Wiesbaden
- Sara Gnadke, ]init[ AG
Inklusiv beteiligen
Standards und Wege zu digitaler Teilhabe für AlleLink zur Session
Inklusive Beteiligung ist kein Luxus, sondern Grundbedingung für echte Demokratie. Menschen mit Behinderung gelten oft als schwer erreichbar, dabei haben sie viel zu sagen! Im Workshop diskutieren wir Beispiele und erarbeiten konkrete Wege, wie digitale Beteiligung für alle gelingen kann.
Wir möchten im Workshop Eckpunkte, gute Voraussetzungen und möglichst partizipative Wege besprechen, um machbare und spezifische Standards inklusiver Beteiligung zu entwickeln, besonders für digitale Formate. Der Fokus liegt darauf, Bedarfe und Potenziale zu identifizieren, Veränderung im jeweiligen Partizipationsgeschehen umzusetzen und in der Beteiligungskultur nachhaltig zu verankern. Im Kern wollen wir in der Workshop-Phase gemeinsam Ansatzpunkte für die eigenen Beteiligungskontexte erarbeiten und diskutieren. Teilnehmende erhalten praxisnahe Impulse, wie sie inklusive Beteiligung vor Ort gestalten, Standards anwenden und hybride Beteiligungsprozesse barrierefrei denken können.
Referierende:
- Mohamed Zakzak, Stadt Pforzheim
- Marc Gottwald-Kobras, Stadt Münster
Partizipation statt Programmierung
Wie migrantische Stimmen KI-Anwendungen mitgestaltenLink zur Session
Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie Menschen kommunizieren, sich informieren und an der Gesellschaft teilhaben. Doch wie stellen wir sicher, dass auch migrantische Perspektiven in die Entwicklung und Anwendung dieser Technologien einbezogen werden – und nicht übersehen bleiben?
Bei „Partizipation statt Programmierung“ übernehmen migrantische Communities die Expert*innenrolle. Mit einem erprobten Testverfahren und fundierten Praxiserfahrungen prüfen sie KI-Anwendungen auf Alltagstauglichkeit, Diskriminierungspotenziale und Relevanz für migrationsspezifische Kontexte.
In der Session stellen wir das partizipative Modell von Nex.KI zur Bewertung und Mitgestaltung von KI-Anwendungen vor. Das eigens entwickelte Testframework deckt stereotype Darstellungen, implizite Vorurteile und Ausschlüsse auf – aus der Perspektive von Menschen mit Migrationserfahrung.
In einer Paneldiskussion geben die Communitymitglieder einen praxisnahen Einblick in das partizipative Evaluationsmodell, zeigen ihre ersten Erkenntnisse aus Community-Checks und diskutieren, wie ein inklusiver, diskriminierungssensibler KI-Einsatz für gesellschaftsrelevante Bereiche gelingen kann.
Referierende:
- Nicola Andersson, La Red – Vernetzung und Integration e. V.
- Annika Wangard, La Red – Vernetzung und Integration e. V.
- Akinola Famson, Afrika-Rat Berlin-Brandenburg e. V.
- Muhajir Hasan, Kurdische Jugend Deutschland e. V.
12. Nov. 2025
10:00
Bürgerbeteiligung mit digitalen 3D-Stadtmodellen
Digitale Beteiligung zugänglicher, anschaulicher und wirksamer machenLink zur Session
Im BMBF-Forschungsprojekt KoodiKo (Kooperative digitale Kommune durch innovative Kommunikations- und Interaktionsstrategien) entwickeln wir gemeinsam mit Bürger*innen, Verwaltung und Fachleuten eine digitale Beteiligungsanwendung auf Basis von 3D-Stadtmodellen. Unser Ziel ist es, komplexe Stadtentwicklungsprozesse anschaulich und zugänglich zu machen und neue Wege der Mitgestaltung zu eröffnen.
In diesem 90-minütigen Workshop stellen wir unsere bisherigen Erkenntnisse und unseren aktuellen Prototypen vor und laden alle Teilnehmenden ein, gemeinsam mit uns zu diskutieren: Was funktioniert? Was fehlt? Was können wir besser machen – besonders mit Blick auf niedrigschwellige Zugänge, Verständlichkeit und tatsächliche Mitwirkung?
Teilnehmende erhalten dabei nicht nur einen exklusiven Einblick in ein innovatives Beteiligungstool und Forschungsprojekt, sondern können eigene Erfahrungen, Anforderungen und Ideen einbringen und Impulse für die Weiterentwicklung ihrer eigenen digitalen Beteiligungsformate mitnehmen.
Referierende
- Anna Stüvermann, BUW
- Camilo Martins, viadukt GmbH
- Dr. Jonathan Seim, Stadt Wuppertal
- Dr.-cand. Iman Baratvakili , Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
- Anne Martin, Institut für Digitale Ethik (IDE)
Gestärkte Inklusion oder BetAIligungs-Dilemma?
Potentiale und Risiken von KI in deliberativen BeteiligungsprozessenLink zur Session
Wie können digitale Tools – insbesondere Künstliche Intelligenz (KI) – dazu beitragen, deliberative Beteiligungsformate wie Mini Publics und Bürgerräte inklusiver, zugänglicher und repräsentativer zu gestalten? Können sie dadurch auch ihre Effektivität, Skalierbarkeit und Wirksamkeit erhöhen? Bedeutet die Anwendung von KI für Teilnehmende eine willkommene Unterstützung oder neue Teilnahmebarrieren? Welche Risiken birgt die Anwendung dieser Technologien für deliberative Prozesse? Was bedeutet die Anwendung von KI für die Teilnehmenden?
In diesem Workshop gehen wir diesen Fragen aus einer praktischen, zugleich kritisch-diskursiven Blickrichtung nach. Dabei werden zunächst die Potenziale und Risiken aus wissenschaftlicher Perspektive des Instituts für Demokratie- und Partizipationsforschung in einem kurzen Input vorgestellt. In sequenziellen Break-Out-Sessions diskutieren und vertiefen die Workshop-Teilnehmenden mithilfe kritischer Denk-Impulse. Zusätzlich werden Einblicke aus der Praxis in die Entwicklung und Verwendung von KI-Tools in deliberative Beteiligungsformate gewährt. Der Workshop fokussiert sich insbesondere auf die Anwendung von KI-Tools in den Bereichen Wissensvermittlung sowie Inklusion und Barriereabbau. Die Ergebnisse aus den sequenziellen Breakouts werden abschließend in einer gemeinsamen Plenumsdiskussion mit allen Teilnehmenden kritisch reflektiert.
Referentin:
- Emilia Blank, Institut Für Demokratie- und Partizipationsforschung
- Lukas Salecker, deliberAIde
- Jason Wagner, Kreis Siegen-Wittgenstein
- Laurenz Scheunemann, Communityräte
- Dr. Constantin Schäfer, ifok GmbH
Künstliche Intelligenz für Bürgerbeteiligung
Chancen, Risiken und neue Wege demokratischer MitgestaltungLink zur Session
Wie kann künstliche Intelligenz die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Politik stärken – und wo liegen ihre Grenzen? In dieser Session erkunden wir das transformative Potenzial von KI für demokratische Beteiligungsprozessen. Wir stellen eine neue, gemeinsam von der OECD und der Bertelsmann Stiftung entwickelte Typologie zur Nutzung von KI in der Bürgerbeteiligung vor und diskutieren konkrete Anwendungsszenarien. Ziel der Session ist es, relevante KI-Anwendungen für aktuelle politische und administrative Herausforderungen zu identifizieren und kritisch über Potenziale und Risiken zu reflektieren.
Referierende:
- Dr. Angela Jain, Bertelsmann Stiftung
- Dr. Stefan Roch, Bertelsmann Stiftung
11:30
Digital statt analog?
Wie gute formelle Öffentlichkeitsbeteiligung gelingt.Link zur Session
Nach dem Auslaufen des Planungssicherstellungsgesetztes ist Deutschland dabei, Formate der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung zunehmend zum Standard in formellen Beteiligungsverfahren zu machen. Doch der Weg dorthin besteht aus zahlreichen Herausforderungen, die sowohl rechtlicher, technischer als auch organisatorischer Gestalt sind.
In diesem Workshop wird ein aktueller Einblick in den "Maschinenraum" der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Es werden die rechtlichen Grundlagen, die neuen Standards und Entwicklungen digitaler Öffenlichkeitsbeteiligung vorgestellt und ein Überblick über aktuelle Zahlen und Daten gegeben. Zudem werden aktuelle Beispiele aus der Praxis vorgestellt.
Referierende:
- Franziska Sperfeld, UfU e. V.
- Katharina Reimann, UfU e. V.
- Dr. rer. pol. Michael Zschiesche, UfU e. V
So sieht digitale Beteiligung 2026 aus
Bedarfe, Trends und LösungenLink zur Session
Wie muss digitale Beteiligung in Zukunft gestaltet sein, um den Anforderungen von 2026 gerecht zu werden?
In diesem Vortrag teilen wir exklusive Erkenntnisse aus zahlreichen Interviews mit Kommunen, Planungsbüros sowie einer Umfrage unter mehr als 500 Bürger*innen. Wir zeigen auf, was digitale Beteiligungsplattformen zukünftig leisten müssen und welche Trends bereits heute sichtbar sind.
Im Vortrag erfahren Sie unter anderem:
- Welche Erwartungen Bürger:innen an die Stadtverwaltung haben, wo und wie sie über Bürgerbeteiligung informiert werden und was ihnen bei digitaler Beteiligung wichtig ist.
- Welche politischen, technologischen und gesellschaftlichen Trends wir 2026 erwarten können.
- Welche Rolle digitale Beteiligungsportale dabei spielen – und welche nicht.
- Vor welchen Herausforderungen Verwaltungsangestellte stehen und welche unterschiedlichen Schlüsse diese für digitale Verwaltung ziehen.
Darüber hinaus geben wir Ihnen einen exklusiven Ausblick auf die Roadmap unserer neuen Beteiligungsplattform, die 2026 erscheinen wird. Die Plattform basiert auf den zentralen Anforderungen, die wir in Interviews und Umfragen mit Kommunen, Planungsbüros und Bürger*innen identifiziert haben. Sie erfahren, wie wir diese Bedarfe in die Weiterentwicklung digitaler Beteiligung einfließen lassen und welche Ansätze künftig für eine höhere Wirksamkeit sorgen werden.
Referent:
- Lukas Wolf, Crowdinsights GmbH
XR-Technologien und Bürgerbeteiligung
Hilft uns die Technologie weiter?Link zur Session
Plötzlich sind sie da: XR-Technologien, eingesetzt in der Bürgerbeteiligung. Was steckt dahinter, was bringt es tatsächlich? Zusammen mit der Technischen Universität Stuttgart haben wir einen praktischen Versuch gestartet.
Die notwendige sozialverträgliche urbane Transformation hin zu klimaneutralen, resilienten und nachhaltigen Städten und Gemeinden, wie sie im Nachhaltigkeitsziel 11 der vereinten Nationen gefordert ist, muss von der Zivilgesellschaft getragen werden, um erfolgreich zu sein. Partizipationsverfahren gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung.
Eine Herausforderung bei der Partizipation sind die frühen Planungsphasen, wobei Beteiligung besonders wichtig ist, aber die Vorhaben für die Bürger*innen noch wenig greifbar sind. Hier können Mixed Reality (XR) Technologien einen wertvollen Beitrag leisten, um durch interaktive Simulation und situative Visualisierungen durch Überlagerung von Planungsdaten und der realen Umgebung einen besseren Eindruck der geplanten Maßnahmen zu vermitteln. Auch die intuitive Mitgestaltung der Planung im Sinne von Co-Creation wird dadurch ermöglicht.
Referierende:
- Martin Müller, Fachverband Bürgerbeteiligung
- Prof. Dr. Volker Coors, Hochschule für Technik Stuttgart
13:30
Awareness in Online-Bürgerbeteiligung
Buzzword oder die Zukunft digitaler Partizipation?Link zur Session
Awareness ist als Haltung und Begriff bereits aus der Festival- und Veranstaltungsbranche bekannt. Awareness-Konzepte können auch dazu beitragen, Partizipationsveranstaltungen als inklusive Safe Spaces zu gestalten. Doch ist das auch übertragbar auf Online-Bürgerbeteiligung? Ist Awareness nur ein schickes neues Buzzword für inklusives Teilnehmendenmanagement, oder bietet es neue Chancen, auch im digitalen Raum?
Im Workshop werden wir nach einer Awareness-Übung zum Einstimmen einen kurzen Impuls geben, was Awareness ist und warum bzw. wann das sinnvoll eingesetzt werden kann. Dann geben wir einen Überblick über die Erfahrungen, die wir bei Bürgerbeteiligungsveranstaltungen mit Awareness-Konzept gemacht haben.
Die Workshop-Teilnehmenden können ihre Erfahrungen mit bzw. ihr Interesse an Awareness in digitalen Räumen beitragen, und gemeinsam identifizieren wir Herausforderungen und Ideen zu deren Bewältigung. Abschließend formulieren wir zusammen zentrale Leitsätze für Awareness bei digitaler Bürgerbeteiligung als Antwort auf die Titelfrage zum Workshop und als Argumentationsgrundlage für die Nutzung von Awareness-Konzepten.
Referierende:
- Dr. Claudia Bosch, nexus Institut
- Ina Metzner, nexus Institut
Bottom-up – Vorschläge für eine aktivierende Beteiligung
Praxiseinblicke aus InnsbruckLink zur Session
Die Stadt Innsbruck hat einen innovativen Ansatz zur Beteiligung von Bürger*innen gewählt. Sie bietet an, auf einer digitalen Plattform Vorschläge einzureichen – mit klaren Kriterien und zu unterschiedlichsten Themen. Erhalten die Vorschläge 80 Stimmen in 50 Tagen, werden Sie von der Stadt geprüft. In unserem Vortrag verknüpfen wir in drei Schritten Theorie und Praxis.
Im ersten Teil wird Go Vocal den theoretischen Rahmen setzen und die Methode zur Bottom-up-Beteiligung mithilfe von offenen Vorschlägen einführen. Im zweiten Teil wird die Stadt Innsbruck aus der Praxis berichten. Nach knapp einem Jahr im Einsatz kann die Stadt Bilanz ziehen und auf eine hohe Beteiligung zurückblicken. Im dritten und letzten Teil werden wir die Bühne öffnen und alle Teilnehmenden der Session einladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.
Referierende:
- Sarah Rasi, Stadt Innsbruck
- Lukas Weiss, Stadt Innsbruck
- Janec Kohlschütter, Go Vocal
Stadt, Bürger*innen, KI
Ein neues Trio für die Planung der Zukunft?Link zur Session
Digitale Bürgerbeteiligung hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel erlebt – von ersten Online-Befragungen bis hin zu interaktiven Beteiligungsplattformen. Mit dem Aufkommen von Künstlicher Intelligenz steht nun ein neues Werkzeug zur Verfügung, das die Beteiligung an Stadtentwicklungsprozessen erneut grundlegend verändern könnte.
Unsere Session beginnt mit einem Input über das Thema Künstliche Intelligenz: Wir zeigen konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI in typischen Phasen der Bürgerbeteiligung, etwa zur barrierearmen Aufbereitung von Informationen oder zur Verbesserung der Auswertung und Darstellung von Beteiligungsergebnissen. Auch für die fachliche Planung bietet KI Potenziale. Zum Beispiel bei der Analyse komplexer Daten oder der Entwicklung von Szenarien.
Neben den Chancen diskutieren wir auch Grenzen und Risiken des KI-Einsatzes mit Blick auf Transparenz, Kontrolle, Verzerrungen oder Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Ziel ist es, gemeinsam auszuloten, welche Rolle KI in der zukünftigen Gestaltung städtischer Beteiligungsprozesse spielen kann und soll.
Referierende:
- Dr. Sarah Ginski-Thiele, Zebralog GmbH
- Dr. Stephan Wilforth, tetraeder.com GmbH
14:30
Bürgergetriebene Innovation
"Ein" Weg aus der KriseLink zur Session
Können Bürger*innen selbst zur Lösung großer Krisen beitragen? In diesem Vortrag wird anhand von zwei beispielhaften Projekten aufgezeigt, wie bürgergetriebene Innovation konkrete Antworten auf gesellschaftliche Krisen liefern kann. Im Zentrum steht die Frage, wie Kommunen das kreative Potenzial der Zivilgesellschaft aktivieren und gezielt in ihre Innovationsprozesse einbinden können, um resilienter auf Zukunftsherausforderungen reagieren zu können.
Vorgestellt wird das Urban-Lab-Projekt „Was wäre, wenn …?“, in dem dieser Ansatz bereits verfolgt wird. Hierbei wird die Stadt Nürnberg ins Jahr 2035 versetzt – in ein Szenario, in dem sie von einer extremen Hitze- und Dürrekrise betroffen ist. Die Bürger*innen werden durch interaktive Formate wie Planspiele und Zukunftswerkstätten animiert eigene Lösungsansätze für eine klimaresiliente Stadt zu entwickeln.
Das Forschungsprojekt ROBIN (Resilienz durch bürgergetriebene Innovation mithilfe digitaler Plattformen) ergänzt diesen Ansatz um technologische Werkzeuge. Ziel ist die Entwicklung einer digitalen, KI-basierten Plattform, die Bürger*innen dabei unterstützt, ihre Innovationsideen eigenständig weiterzuentwickeln und umzusetzen und sie so befähigt systematisch an der Lösung lokaler Herausforderungen mitzuwirken.
Referierende:
- Timon Sengewald, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- Michael Niqué, Urban Lab gemeinnützige UG
Scrollytelling in der Stadtentwicklung
Geschichten mit Karten erzählenLink zur Session
Komplexe Inhalte vermitteln als Einstieg in eine Diskussion – das geht nur mit Powerpoint von der Bühne? Mit einer Kombination aus Karten, Geodaten, Text und Bild lassen sich auch komplexe Themen so aufbereiten, dass Bürger*innen sie sich interaktiv und niedrigschwellig online erschließen können.
Texte, Bilder, Daten und Videos zu einer interaktiven Geschichte verweben: Das kann Scrollytelling. So arbeiten mittlerweile auch viele etablierte Medien in ihren Online-Formaten, um komplexe Sachverhalte anschaulich aufzubereiten. Die Lesenden scrollen und klicken sich durch das dramaturgisch aufbereitete Material, gelesen wird nicht zwingend linear, sondern interaktiv. Um es Bürger*innen im Kontext von Stadtentwicklungsprojekten zu ermöglichen, sich Hintergründe und Zusammenhänge einfacher als mit ellenlangen Textstudien zu erschließen, wurde das Tool DIPAS_stories als Ergänzung des Digitalen Partizipationssystems DIPAS entwickelt, das Kartenmaterial und Geodaten mit Text, Bild oder Video kombiniert.
Die Session zeigt an aktuellen Anwendungsbeispielen, wie Scrollytelling in der Stadtentwicklung funktioniert und welche Vorteile sich dadurch in der Kommunikation und für die Bürgerbeteiligung ergeben.
Referentin:
- Astrid Köhler, Freie und Hansestadt Hamburg
15:30
"Bitte einloggen!"
Demokratie beginnt mit Beteiligung – digital wie analogLink zur Session
Wenn Meinungen zu Fronten werden, gerät unsere Demokratie ins Wanken. Die zunehmende Polarisierung im Netz bedroht den respektvollen Austausch und schwächt das demokratische Miteinander. In Zeiten, in denen soziale Medien oft Gräben vertiefen, statt Brücken zu bauen, wollen wir darüber sprechen, wie wir im digitalen Raum wieder mehr Dialog, Verständnis und Zusammenhalt fördern können. Demokratie lebt vom Mitmachen, ob durch politische Beteiligung, Engagement in Online-Communities, Vereinen oder digitalen Initiativen. Es ist an uns allen, die demokratische Debattenkultur auch im Internet zu schützen und aktiv mitzugestalten. Unser Workshopformat der ZUKUNFTS(T)RÄUME setzt genau hier an, denn Demokratie braucht dich – analog wie digital.
Mit einem inspirierenden Panel, offenen Gesprächsrunden und einer kreativen Zukunftswerkstatt laden wir dich ein, deine Perspektive einzubringen und gemeinsam neue Antworten auf die Herausforderungen digitaler Demokratie zu entwickeln. Es geht um Einigkeit in der Uneinigkeit, um digitale Aufmerksamkeit, konstruktive Auseinandersetzung und die Freude daran, Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Zukunft beginnt mit dir und mit dem Mut, im digitalen Raum Fragen zu stellen, die neue Wege eröffnen.
Das erwartet dich beim Zukunftstraum:
Verändern – Demokratie im digitalen Alltag leben
Wir zeigen Menschen, die online wie offline mit kleinen Schritten Großes bewirken, in Initiativen, digitalen Communities oder durch couragiertes Handeln im Netz. Mit Austausch, mit Fokus auf praxisnahen Beispielen erkunden wir, wie aus Ideen konkrete Handlungsmöglichkeiten entstehen und wie du selbst Teil davon wirst.
Zuhören – digitale Demokratie mitgestalten
Wir hören hin: Was braucht es, um uns im digitalen Raum nicht zu verlieren, sondern zusammenzufinden? Welche Werte wollen wir verteidigen und wie? Deine Ideen, Erfahrungen und Fragen sind gefragt. Denn digitale Zukunft beginnt mit deinem Blick und deiner Stimme.
Verbinden – digitale Gemeinschaft erleben und stärken
In interaktiven Gesprächsformaten, Kleingruppen und unserer kreativen Zukunftswerkstatt öffnen wir Räume für Austausch, Vernetzung und neue Perspektiven. So entsteht ein digitales Miteinander, das Unterschiede aushält und Demokratie auch im Netz erfahrbar macht.
Referierende:
- Hanno Hildebrand, GermanDream gGmbH
- Mehria Ashuftah, GermanDream gGmbH
- Ziyad Khalaf Farman, GermanDream gGmbH
- Franziska Berge, berge consulting
Geringe Literalität
Wie wir unbewusst fast ein Drittel aller Erwachsenen von Beteiligungsprozessen ausschließenLink zur Session
In Deutschland können 6,2 Millionen Menschen nicht lesen und schreiben. Jede*r fünfte Erwachsene in Deutschland liest und schreibt wie ein Grundschulkind. Was das insbesondere für digitale Partizipationsprozesse bedeutet – und was wir daran ändern können – berichtet das Projektteam von „Leicht gemacht“.
Das Projekt „Leicht gemacht – Beteiligung für gering literalisierte Erwachsene“ begleitet seit August 2023 digitale Beteiligungsprozesse in Berlin-Neukölln.
Wussten Sie, dass jede*r fünfte Erwachsene in Deutschland nur auf dem Niveau eines Grundschulkinds lesen und schreiben kann? Wussten Sie, dass jede*r achte Erwachsene in Deutschland nur maximal einen Satz, aber keine längeren Texte schreiben kann?
Falls Sie das bislang noch nicht wussten und auch entsprechend noch nicht darüber nachgedacht haben, wie Sie es in Ihrem Arbeitskontext berücksichtigen können, sind Sie nicht allein!
Denn: Bisher wird diese Zielgruppe bei Beteiligungsverfahren, insbesondere in digitaler Partizipation, selten mitbedacht.
Das hat – unserer Meinung nach – große Auswirkungen auf (digitale) demokratische Prozesse.
Wie viel funktioniert in Ihrer Arbeit über Schriftsprache, Informationsvermittlung über Geschriebenes oder Rückmeldungen in schriftlicher Form? Wie schriftsprachreduziert gestalten Sie digitale Beteiligungsprozesse?
„Leicht gemacht“ ist ein Pilotprojekt in Deutschland, initiiert von der Landeszentrale für politische Bildung Berlin. Wir ermöglichen und bestärken Menschen, die nicht oder kaum lesen und schreiben können, sich zu beteiligen. Dafür begleiten wir seit August 2023 bezirkliche Beteiligungsverfahren – digital und vor Ort – in Berlin-Neukölln.
Wir ermutigen Verwaltung und Agenturen, Beteiligungsangebote mit weniger Schrift- und Fachsprache anzubieten.
Unsere Erkenntnisse möchten wir gern mit Ihnen teilen und diskutieren.
Was wir zur Session mitbringen:
- Informationen zur Zielgruppe „gering literalisierte Erwachsene“
- Einordnung der Nutzung von digitalen Medien durch die Zielgruppe
- Informationen zum Verhältnis der Gruppe zu Partizipation und Einordnung zur Nutzung digitaler Partizipationsmöglichkeiten durch die Zielgruppe
- Strategien und Bedingungen zur Einbindung der Zielgruppe in digitale partizipative Prozesse
- Erfahrungsberichte aus der Begleitung von Online-Beteiligungsformaten
Was wir uns von Ihnen wünschen:
- Neugier
- Lust, eigenes Handeln/eigene Handlungsstrategien zu erweitern
Das Projekt „Leicht gemacht“ wird im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Berlin gefördert.
Referierende:
- Hannah Zacher, Bürgerstiftung Neukölln
- Paula Palacios Blasco, Bürgerstiftung Neukölln
- Swantje Malz, Bürgerstiftung Neukölln
Politische Bildung über TikTok
Wie wir die GenZ für Demokratie begeisternLink zur Session
Die Bundestagswahl 2025 hat erneut verdeutlicht: Der Einfluss von Social-Media-Plattformen auf die politische Meinungsbildung junger Menschen ist enorm. Sie spielen eine zentrale Rolle im Austausch über gesellschaftliche und politische Themen, da sie Teil ihrer alltäglichen Lebenswelt sind.
Als Zivilgesellschaft müssen wir uns daher folgende Fragen stellen: Wie können wir in digitalen Räumen wirken, um junge Menschen zu erreichen? Welche Potenziale bieten sich für politische Bildung? Und wie können wir Ressourcen und Know-how bündeln, um gemeinsam eine größere Wirkung zu erzielen?
Die DFL Stiftung hat im Juni 2024 ihren TikTok-Kanal @thebeautifulgame_official gestartet und mit ihrer Kampagne „#DEMOKRATEAM – Alles andere ist Abseits.“ die positive Kraft des Fußballs für demokratische Werte auf TikTok eingesetzt. Zudem hat sie die TikTok-Stiftungsallianz „#Mission232: Demokratie stiften. Extremismus abwählen“ initiiert.
In der Session bekommen die Teilnehmenden einen Einblick in Erkenntnisse aus eineinhalb Jahren TikTok-Engagement und lernen Ansätze und Ideen kennen, die sich auch auf andere Organisationen übertragen lassen. Außerdem wird erläutert, wie ein Zusammenschluss mit anderen Akteur*innen gelingen kann und welche Chancen sich durch das gemeinsame Wirken ergeben.
Referierende:
- Andrea Bonk, DFL Stiftung
- Elisabeth Brachmann, Stiftung Polytechnische Gesellschaft